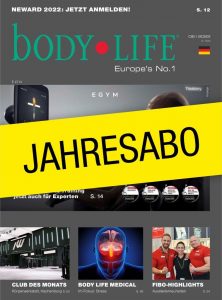Stress und Gesundheit
Macht Stress krank?
Die Weltgesundheitsorganisation bezeichnet Stress als eine der größten Gesundheitsgefahren des 21. Jahrhunderts. Symptome wie Erschöpfung und Burnout sind in der modernen, digitalen Welt allgegenwärtig. Wie lässt sich Stress überhaupt definieren, welches sind die größten Risikofaktoren und welche Möglichkeiten der Stressbewältigung gibt es?
In einer 2021 veröffentlichten Stressstudie der Techniker Krankenkasse berichteten mehr als ein Viertel der befragten Deutschen, häufig gestresst zu sein. Unter den häufig Gestressten äußerten 74 Prozent Muskel- und Rückenbeschwerden. Empfindungen wie „Erschöpfung“ und „Ausgebranntsein“ belegten allerdings mit 80 Prozent Platz eins der Leiden häufig Gestresster. Unter den selten Gestressten gaben derartige Emotionen nur 13 Prozent an. Die Befragten repräsentieren den Querschnitt der volljährigen Bevölkerung in Deutschland.
Definition
Ursprünglich stammt das Phänomen „Stress“ aus der Werkstoffkunde und steht dafür, wie sehr sich ein Objekt unter Einwirkung einer definierten Kraft verbiegt. Im medizinischen Kontext ist Stress eine physische Reaktion auf einen Reiz zur kurzfristigen Leistungssteigerung ohne krank machende Wirkung. Physiologisch betrachtet, bezeichnet der Begriff „Stress“ eine komplexe Interaktion endokriner Systeme und hormoneller Regelkreise, Entzündungsmediatoren und chemischer Reaktionen mit vielfältigen Folgen. Wird ein Reiz physisch oder psychisch als Stress wahrgenommen, werden zwei physiologische Systeme aktiviert: das sympathomedulläre System, das über die nervöse Ansteuerung des Sympathikus eine organische Reaktion – die Fight-or-Flight-Reaktion – auslöst, und das allgemeine Anpassungssyndrom auf der Hypothalamus- Hypophysen-Nebennierenrinde-Achse, das auf hormonellen Reaktionen basiert. Beide Systeme stimulieren sich wechselseitig mit dem Ziel, den Organismus wieder in die Homöostase, das innere Gleichgewicht, zu bringen. Aus evolutionärer Sicht sicherte Stress auf diese Weise das Überleben.
Das Fight-or-Flight-Syndrom beschreibt die kurzfristigen, sekundenschnellen Anpassungen des Organismus auf bedrohliche äußere Reize. Der Hypothalamus aktiviert über den Sympathikus die Ausschüttung von Katecholaminen, wie z. B. Adrenalin, Noradrenalin, Serotonin und Dopamin, im Nebennierenmark, die physiologische Reaktionen auslösen: Steigerung der Herzfrequenz und des Herzminutenvolumens, vermehrte Durchblutung von Muskulatur, Haut und Gehirn, Erhöhung der Sauerstoffaufnahme und verringerte Blutgerinnung sowie Anstieg des Blutzuckers zur Energiebereitstellung sind die Folgen. Der Organismus ist zu Flucht oder Kampf bereit. Über die Hypothalamus-Hypophysen- Nebennierenrinde-Achse kommt es zur Freisetzung weiterer Hormone, z. B. Cortisol, die spezifische und unspezifische Abwehrprozesse bzw. Immunreaktionen auslösen. Ist eine bestimmte Konzentration des Cortisolspiegels erreicht, wird die Hormonproduktion verringert. Auf die Phase der Anspannung folgt die Phase der Regeneration. Sind die Phasen der Entspannung zu kurz oder fehlen sie gänzlich, kommt es zu andauerndem oder gar chronischem Stress. Die Folge ist ein dauerhaft erhöhter Stresshormonspiegel, der dem Körper und der Seele ernsthaft schaden kann. Das Immunsystem wird beeinträchtigt, das Risiko für Herz-Kreislauf-, Stoffwechsel-, Magen-Darm- und psychische Erkrankungen steigt.
Der Faktor Psyche
Psychische Erkrankungen gehören zu einer der häufigsten Arbeitsunfähigkeitsgründe in Deutschland, berichtet der Gesundheitsreport 2021 der Techniker Krankenkasse. Und was stresst die deutsche Bevölkerung am meisten? Die Stressstudie fasst die Top-5-Stressoren nach Angaben der Befragten in der nachstehenden Rangfolge zusammen:
- Schule, Studium, Beruf,
- hohe Ansprüche an sich selbst,
- Krankheit von Nahestehenden,
- Konflikt in der Partnerschaft/Familie,
- ständige Erreichbarkeit durch Smartphone/Social Media.
Wie sich die Stressbelastung der Deutschen in den letzten Jahren unter Berücksichtigung der Coronapandemie verändert hat, wurde in mehreren Studien untersucht. In einer 2021 veröffentlichten Längsschnittstudie der Universität Mannheim im Fachbereich Gesundheitspsychologie wurde eine zufällige, für die volljährige deutsche Bevölkerung repräsentative Stichprobe von 3 500 Teilnehmern zu mehreren Zeitpunkten zu ihrer psychischen Gesundheit und ihrem Gesundheitsverhalten im Zeitraum von März bis Juni 2020 (während des ersten Lockdowns der Coronapandemie) und den Folgemonaten befragt. Die psychische Gesundheit wurde anhand der Angaben der Studienteilnehmer zu Angst, Depression und Einsamkeit analysiert. Informationen zu Bildschirmzeit, Snackkonsum und körperlicher Aktivität bildeten die Basis der gesundheitsbezogenen Verhaltensweisen. Die Studienergebnisse zeigten, dass die psychische Gesundheit über den ersten Lockdown hinaus nicht signifikant beeinträchtigt wurde. Auch wenn Angst, Depression und Einsamkeit zu Beginn des Lockdowns zunahmen, relativierte sich dieser Effekt über den Betrachtungszeitraum aufgrund von Gewöhnungsmustern. Im Zusammenhang mit dem Gesundheitsverhalten zeigten sich ähnliche Auswirkungen. Die Bildschirmzeit und der Snackkonsum nahmen zu Beginn des Lockdowns deutlich zu, die körperliche Aktivität nahm deutlich ab. Mit Ausnahme der Bildschirmzeit erreichte das Gesundheitsverhalten zum Ende des Studienzeitraums vergleichbare Werte wie vor der Pandemie. Die Bildschirmzeit war jedoch auch zum Ende des Betrachtungszeitraums deutlich höher als zu Beginn des Lockdowns. Die Studie untersuchte auch den Zusammenhang zwischen psychischer Gesundheit und Gesundheitsverhalten und bestätigte, dass gesundheitsfördernde Verhaltensweisen eindeutig mit Indikatoren einer besseren psychischen Gesundheit verbunden waren.
Nach weiteren Lockdowns und fortschreitender Pandemie stieg die Stressbelastung der Deutschen zunehmend an. 47 Prozent aller Befragten der Stressstudie der Techniker Krankenkasse äußerten 2021 ein höheres Stressniveau seit Pandemiebeginn. Aus dem Vergleich der Ergebnisse der Stressstudien der Techniker Krankenkasse 2021, 2016 und 2013 geht hervor, dass das Stresslevel der deutschen Bevölkerung in den letzten acht Jahren signifikant zugenommen hat.
Stresswahrnehmung
Ob Stress als positiv oder negativ erlebt wird, ist nach dem psychologischen Stressmodell nicht zuletzt eine Frage der Bewertung. 2012 bestätigte eine Studie der Universität Wisconsin anhand einer repräsentativen Stichprobe von über 28 000 Amerikanern, dass sowohl häufig erlebter Stress als auch die Wahrnehmung, dass Stress die Gesundheit beeinträchtigt, unabhängig voneinander mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit schlechterer gesundheitlicher und psychischer Folgen verbunden sind. Die Menge an Stress und die Wahrnehmung, dass Stress gesundheitsgefährdend und schädlich ist, sowie die Mortalität interagierten. Diejenigen, die berichteten, viel Stress zu haben und dass Stress ihre Gesundheit stark beeinträchtigte, hatten ein um 43 Prozent erhöhtes Risiko eines vorzeitigen Todes. Bei den Studienteilnehmern, die angaben, Stress wirke positiv und sporne zu Leistung an, wurde im Vergleich zu denjenigen, die wenig Stress hatten, ein geringeres Sterberisiko ermittelt.
Der Frage, ob sich eine veränderte mentale Einstellung zu Stress auf die physische Stressreaktion auswirkt, sind Psychologen der Stanford Universität nachgegangen. Sie konnten anhand des Blut-Cortisol- Spiegels belegen, dass die Bewertung eines Stressors entscheidend für die körperliche Stressreaktion ist. Die Probandengruppe, der eine positive Einstellung zu Stress in einem Video veranschaulicht wurde, reagierte mit einem niedrigeren Cortisolspiegel und konnte ihren Herzschlag schneller wieder senken als die Probandengruppe mit negativen Assoziationen zu Stress. Aus medizinischer und psychologischer Sicht ist ein ausgewogenes Maß an Stress gesundheits- und leistungsfördernd. Die Wege, wie die Herstellung einer Work-Life-Balance oder das Gleichgewicht zwischen An- und Entspannung gelingen kann, sind so variabel und multimodal wie individuell. Es existieren vielfältige wissenschaftliche Studien, Metaanalysen und Übersichtsarbeiten zu Stresspräventions- und Stressbewältigungsprogrammen für gesunde und Burnout-gefährdete Personen und arbeitsbezogene Stressmanagementstrategien. Für achtsamkeits- und entspannungsbasierte Ansätze zum präventiven Stressmanagement gibt es zahlreiche evidente Wirksamkeitsnachweise. In Metaanalysen zeigte sich, dass kognitiv-behaviorale Interventionen im Zusammenhang mit arbeitsbezogenem Stress den größten Effekt im Vergleich zu klassischen Entspannungsverfahren und multimodalem Stressmanagement hatten. Die Effektstärken waren jedoch für alle untersuchten Stressmanagementansätze signifikant. Der kognitiv-behaviorale Ansatz zielt darauf ab, den Stressor individuell neu zu bewerten und eine neue Sichtweise/Perspektive auf den Stressauslöser zu schaffen, die weniger Stress verursacht.
Bewegung entschleunigt
Die evolutionäre Antwort auf Stress ist körperliche Aktivität. Sie beeinflusst die Stresshormonregulation positiv, senkt den Cortisolspiegel und schüttet Glückshormone aus. Das minimiert nicht nur das Stressniveau, sondern verbessert auch die psychische Gesundheit. Dass regelmäßige körperliche Aktivität präventive Auswirkungen auf die Entstehung von kardiovaskulären, orthopädischen, neurologischen und metabolischen Erkrankungen hat, gilt als wissenschaftlich gesichert. Eine Querschnittsstudie der Universität Basel und kooperierender schwedischer Universitäten konnte nachweisen, dass moderates Ausdauertraining bei gestressten Menschen neben der Reduktion kardiovaskulärer Risikofaktoren einen positiven Effekt auf das subjektiv empfundene hohe Stressniveau hat.während der Pandemie spiegelte körperliche Aktivität eine erfolgreiche Stressbewältigungsstrategie wider, wie u. a. die Ergebnisse der im Januar 2021 veröffentlichten Längsschnittstudie der Stanford Universität an 990 erwachsenen Amerikanern zeigen. Körperliche Aktivität war signifikant mit weniger Stress verbunden. Fernsehen, Schlafen oder Essen als Strategie zur Stressbewältigung führte zu einem erhöhten Stresslevel. Die körperliche Aktivität wurde nach den Richtlinien der American Heart Association (2007) definiert und umfasste eine regelmäßige körperliche Aktivität mit aerober Belastung mit moderater bis hoher Intensität 3- bis 5-mal pro Woche.
Die World Health Organisation (WHO) stellt heraus, dass körperliche Aktivität entscheidend für die Gesundheit und das Wohlbefinden ist, und empfiehlt Erwachsenen von 18 bis 64 Jahren 150 bis 300 Minuten aerobe Aktivitäten mit moderater Intensität oder 75 bis 150 Minuten aerobe Aktivität mit hoher Intensität. Eine gleichverteilte Kombination beider Belastungsarten ist ebenfalls möglich. Die Ergänzung von Krafttraining mit mindestens moderater Intensität an zwei Tagen pro Woche erzielt laut WHO einen weiteren gesundheitlichen Benefit. Eine Kombination aus Bewegungsaktivitäten mit koordinativen, gleichgewichtsfördernden und kraftaufbauenden Inhalten empfiehlt die WHO Erwachsenen ab dem 65. Lebensjahr an mindestens drei Tagen pro Woche.
Fazit
Stress ist eine „Meisterleistung“ unseres Organismus, aber auch eine der größten Gesundheitsgefahren unserer digitalisierten Welt. Wie Stress erlebt wird, kann über eine Neubewertung des Stressors gelingen und die Einstellung, dass Stress generell eher Freund statt Feind ist. Nach fordernden Phasen immer wieder für Entspannung, Regeneration und Ausgleich zu sorgen, sollte Teil eines gesundheitsorientierten Umgangs mit sich selbst sein, um präventiv vor chronischem Stress und seinen negativen Auswirkungen wie Burnout oder Depressionen geschützt zu sein. Das Stressverhalten lässt sich bewusst ändern. Stressbewältigungsstrategien sind vielfältig, sehr individuell und aus dem jeweiligen beruflichen und privaten Kontext zu betrachten. Auch gesundheitsbezogene Verhaltensweisen können das Stressempfinden positiv beeinflussen. Um individuelle, gezielte Stressbewältigungsstrategien zu entwickeln, ist es sinnvoll, Screening- oder Diagnostikinstrumente insbesondere in der Primärprävention einzusetzen und neben den physischen Stressreaktionen mit seinen Auswirkungen auf den Organismus auch die psychosoziale Ebene und die beruflichen Kontextfaktoren in die Istanalyse und Maßnahmenempfehlung einzubinden.
Isabelle Butz
Literatur auf Anfrage bei der Autorin erhältlich.

Isabelle Butz
ist Diplom-Sportwissenschaftlerin mit langjähriger Erfahrung in der ambulanten orthopädischen, neurologischen und kardiologischen Rehabilitation sowie im Gesundheits- und Rehabilitationssport. Sie ist IHK-zertifizierte Fachkraft für Stressmanagement und außerdem Leiterin der mobee ® 360-Akademie mobee®versity“ für digitale Diagnostik.
Foto: BillionPhotos.com – stock.adobe.com; Isabelle Butz